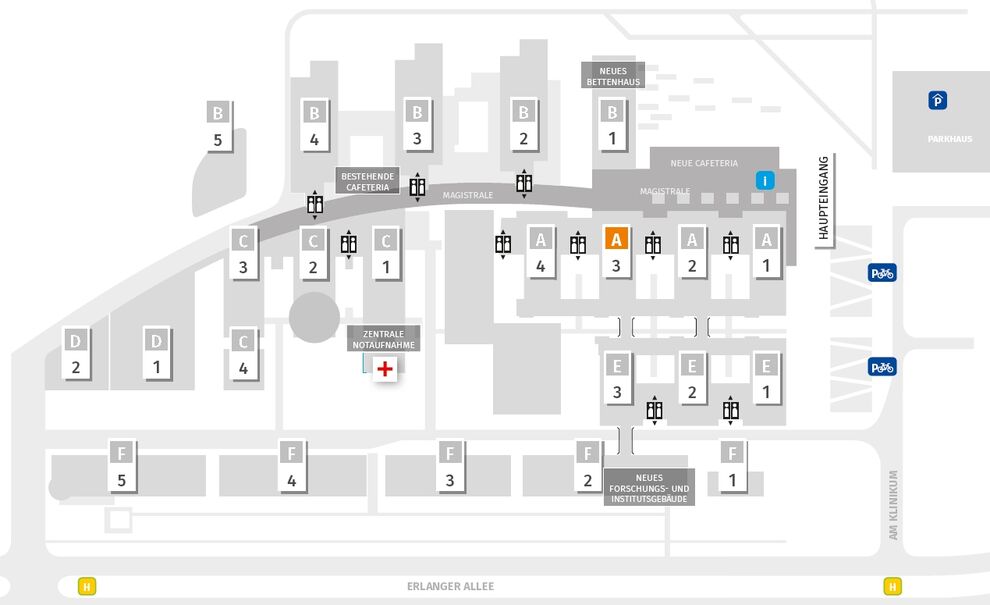In der chronischen Krankheitsphase können rezidivierende Beschwerden und Leistungsminderung immer wieder in Konflikt mit dem vor der Erkrankung häufig sehr aktivem Selbstbild und Lebensstil geraten und zu ständigem, oft erfolglosem und zermürbendem inneren Grübeln oder Ankämpfen gegen die Erkrankung führen. Insofern stellt eine Herzerkrankung für die betroffenen Patienten eine erhebliche psychische Belastung dar, die von der Alltagsrelevanz her u. U. bedeutsamer werden kann als die direkte körperliche Schädigung. Depressive Verstimmungen finden sich je nach Krankheitssituation und Krankheitsschwere bei bis zu 50 % der Herzpatienten und sind somit relativ häufig. Krankheitswertige Anpassungs- und Belastungsstörungen bei kardialen Erkrankungen treten nach amerikanischen und deutschen Untersuchungen zu 20 bis 25 % auf. Patienten mit lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen oder überlebtem plötzlichem Herztod entwickeln bis zu 50 % Symptome einer Angsterkrankung und / oder (reaktiven) Depression.
Andererseits ist nachgewiesen, dass gerade herz- und koronargefährdende Verhaltensweisen individuell oft eine wichtige antidepressive Rolle spielen. So ist der antidepressive Effekt des Tabakrauchs gut bekannt oder die antidepressive Wirkung von Nahrungsaufnahme im Sinne von „Frustfressen“. Bei Depression besteht eine Antriebshemmung bezüglich (empfohlener) körperlicher Aktivität sowie, in Studien nachgewiesen, eine signifikante Medikamentenunverträglich auch zu anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen. Auch hieraus resultiert, dass insbesondere depressive Symptome das mittlere Sterberisiko bei bekannter Herzerkrankung signifikant erhöhen.
Schon die Vorstellung herzkrank zu sein ist ja schwer erträglich und eine zusätzliche psychische Symptomatik wird dann oft aus Scham nicht nach außen gezeigt. Darauf kann aber durch psychokardiologische Gespräche im Rahmen unseres Angebotes einer fachgebundenen psychotherapeutischen/psychokardiologischen Sprechstunde außerhalb der „Apparatemedizin“ entlastend und hilfreich unterstützend eingegangen werden. Wichtig ist dies auch vor dem Hintergrund, dass bei unbehandelten Anpassungsstörungen die Chronifizierung und der Übergang in schwere depressive Episoden oder eine anhaltende Angststörung drohen.